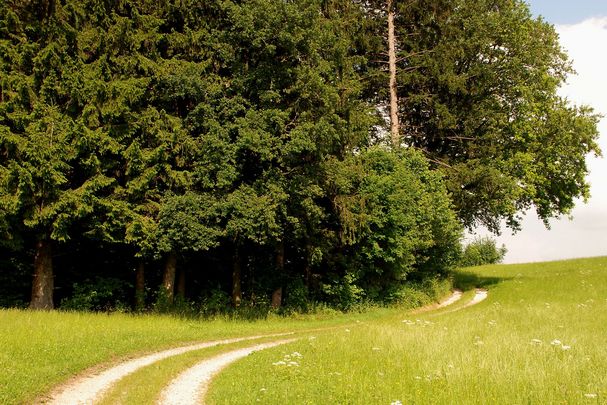Unser Wald
Deutschland ist eines der waldreichsten Gebiete Mitteleuropas - besonders unsere Buchenwälder sind weltweit einzigartig und wir haben eine besondere Verantwortung für sie.
Von Natur aus wären in unseren Wäldern vor allem Laubbäume vertreten, die wirtschaftliche Nutzung führte jedoch zu einem starken Anstieg von Fichten und Kiefern. Bereits Anfang der 90-er Jahre zeigte sich, dass diese Form der Waldbewirtschaftung keine Zukunft hat.
Waldexkursionen der BUND Naturschutz Kreisgruppe Traunstein
Überregionale Informationen des BUND Naturschutz finden Sie auf der Website unseres Landesverbandes